Soziale Medien und die deutsche Sprache - Freunde oder Feinde?
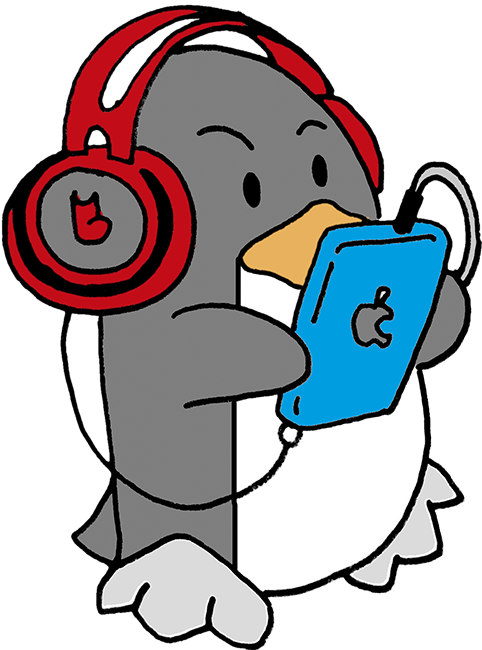 „Lass shoppen gehn!“, „K bae!“ Das sind Beispiele für Begriffe und Ausdrücke, die täglich in sozialen Medien benutzt werden. Die beliebtesten Plattformen der Jugendlichen sind soziale Medien, auf denen man Nachrichten versenden kann wie WhatsApp oder Instagram (M2: Statistiken zur Mediennutzung, 2018). Auf diesen kann ein Unterschied zu der deutschen Standardsprache erkannt werden, weil beispielsweise Anglizismen und Abkürzungen benutzt und die Grammatikregeln nicht eingehalten werden. Es entsteht also die Frage, ob durch soziale Medien ein Sprachverfall verursacht wird. Einige behaupten, die Sprache verliere an Wert, aber für einige stellt diese Veränderung eine positive und unvermeidliche Entwicklung dar. Im Folgenden sollen Vor- und Nachteile zur Problematik genannt und mein eigener Standpunkt schließlich verdeutlicht werden.
„Lass shoppen gehn!“, „K bae!“ Das sind Beispiele für Begriffe und Ausdrücke, die täglich in sozialen Medien benutzt werden. Die beliebtesten Plattformen der Jugendlichen sind soziale Medien, auf denen man Nachrichten versenden kann wie WhatsApp oder Instagram (M2: Statistiken zur Mediennutzung, 2018). Auf diesen kann ein Unterschied zu der deutschen Standardsprache erkannt werden, weil beispielsweise Anglizismen und Abkürzungen benutzt und die Grammatikregeln nicht eingehalten werden. Es entsteht also die Frage, ob durch soziale Medien ein Sprachverfall verursacht wird. Einige behaupten, die Sprache verliere an Wert, aber für einige stellt diese Veränderung eine positive und unvermeidliche Entwicklung dar. Im Folgenden sollen Vor- und Nachteile zur Problematik genannt und mein eigener Standpunkt schließlich verdeutlicht werden.
Zuerst sollte erwähnt werden, dass in den sozialen Medien die gängigen Regeln der deutschen Sprache nicht eingehalten werden. Es wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, es erfolgt keine Zeichensetzung und Wörter werden ausgelassen, z.B. Artikel (vgl. M1: Herbold, 2008). Auch Emojis und Sticker, die laut Herbold „[…] längst ein ästhetisches Eigenleben [führen]“ (M1: Herbold, 2008), wurden in den sozialen Medien eingeführt und ersetzen Wörter. Dennoch stellen diese ganzen Unterschiede einen Vorteil zu der klassischen Grammatik dar. Abkürzungen sorgen dafür, dass nur wesentliche Informationen vermittelt werden und laut der Germanistik-Professorin Heike Wiese „[…] ist [das] […] sehr ökonomisch“ (M3: Mens, 2003). Zeit wird also gespart, weil längeres Schreiben vermieden wird: Viele Apps ermöglichen es auch, Audio-Nachrichten aufzunehmen und diese an eine andere Person zu senden. Emojis und Sticker dienen außerdem zu einem besseren Ausdruck, weil sie Gefühle veranschaulichen.
Sprache wird in den sozialen Medien dafür benutzt, um zu entscheiden, wie man sich öffentlich präsentieren will. In Chat-Gruppen mit Freunden wird eine bestimmte Jugendsprache benutzt, aber wenn man mit anderen Individuen kommuniziert, wird eine andere Schreibweise benutzt: „Mal wird mehr, mal weniger regelkonform geschrieben, je nachdem, was die Nutzer in der jeweiligen Situation als angemessen empfinden“ (M1: Herbold, 2013). Das kann zu Missverständnissen führen, weil viele Nutzer Probleme dabei haben, sich an den Kontext anzupassen und „diesen souveränen Umgang mit Sprache zu beherrschen“ (M1: Herbold, 2013). Sie gewöhnen sich so sehr an die Sprache in sozialen Medien, dass sie sich von der deutschen Standardsprache entfernen und diese sogar verweigern. Trotzdem kann aus dieser Situation eine Fähigkeit entstehen: Die Schreiber können lernen, mühelos zwischen Stilen und Schreibweisen zu wechseln und sich adressatenbezogen zu äußern (vgl. M1: Herbold, 2013).
Sprache in sozialen Medien verursacht eine Unterscheidung der verschiedenen Generationen, was gleichermaßen zu einer Abgrenzung führt. Begriffe, die Jugendliche benutzen, werden vor allem von älteren Leuten nicht verstanden und so können Kommunikationsprobleme entstehen: „Manchmal verstehen Erwachsene nur Bahnhof“ (M3: Mens, 2008). Auch geschieht eine Einteilung der Jugendlichen in Gruppen, weil nicht jeder Teenager in derselben Art und Weise spricht: „[…] In jeder Region, Stadt, Schule, ja sogar Clique kursieren andere Wörter […]“ (M3: Mens, 2008).
Doch wenn dieses Phänomen aus einer anderen Perspektive betrachtet wird, lässt es sich sagen, dass ein Zugehörigkeitsgefühl der Jugendlichen entwickelt wird: „Typischerweise wenn sie in einer Gruppe mit Gleichaltrigen zusammenstehen und kommentieren, was drumherum passiert“ (M3: Mens, 2008). Jugendliche, die zu einer bestimmten Gruppe gehören, haben ähnliche Schreibweisen. Das hängt mit dem eigenen Konzept der Identität eng zusammen, weil man permanent auf der Suche ist, gleiche Werte und Einstellungen mitzuteilen und man sich an diesen Maßstäben orientiert, wenn man Freundesgruppen auswählt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sprache auf sozialen Medien bestimmte Veränderungen mit sich bringen. Diese Veränderung wird einerseits als ein Verfall betrachtet, weil man behauptet, die Sprache verliere an Wert, da die Grammatikregeln nicht eingehalten werden, Anglizismen deutsche Begriffe ersetzen und eine Abgrenzung zu anderen Generationen entsteht. Andererseits „[…] ist [es] so, als habe die Menschheit das Schreiben neu entdeckt“ (M1: Herbold, 2013). Die Veränderungen können dem Verständnis dienen und Individuen einer Gruppe zusammenbringen. Meiner Meinung nach ist die Veränderung der Sprache unvermeidlich. Neue Wörter werden ständig gebildet oder aus anderen Fremdsprachen entnommen, was dafür sorgt, dass wir nicht die gleiche Variante des Deutschen sprechen als die Menschen in vergangenen Jahrhunderten. Auch die Nutzung sozialer Medien steigt stetig an und immer mehr Personen laden Apps herunter, die es möglich machen, Nachrichten zu senden und somit die Regeln der deutschen Sprache herauszufordern. Wir leben in einer globalisierten Welt und wir müssen uns an sie anpassen, weil das Einzige, das in unserer Welt konstant bleibt, die Veränderung ist.
Fernanda Armas, IV.4
Verwendete Quellen:
- Astrid Herbold: Chats belegen das Gegenteil von Sprachverfall. 2013 (zu finden unter http://www.zeit.de/digital/ internet/2013-01/chat-sprache-forschung)
- Fenja Mens: Was guckst Du, bin isch Kino? In: Spiegel vom 21.06.2008 (zu finden unter http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/jugendsprache-was-guckst-du-bin-isch-kino-a-556366.html (Beispiele zur Jugendsprache redaktionell aktualisiert)
- JIM-Studien: Statistiken zur Mediennutzung. Liebste Lernangebote und wichtigste Apps, 2017.